
DAS MÄRCHEN VON DER ZUKUNFT
Ich habe dieses Märchen ungefähr Ende der siebziger Jahre geschrieben, daher sollte es vielleicht teilweise überholt sein. Viel schlimmer ist jedoch, daß es inzwischen teilweise wahr geworden ist...
Seit der Heidelbeerenzeit sind nun schon ein paar Monate vergangen.
Wie jedes Jahr hatten wir uns in der letzten Juliwoche Urlaub genommen, meine Frau und ich, und waren hinaufgefahren nach Nordland. Es war nicht nur wegen der Heidelbeeren, die es dort in Hülle und Fülle gibt, sondern es war auch jedes Mal ein Naturerlebnis. Und es tat ganz gut, sich einmal im Jahr vom Großstadtleben zu erholen.
Wir waren also mit dem Schlafwagen der schwedischen Eisenbahn gegen Norden gerollt. Bis Lycksele konnten wir mit dem Zug fahren. Von dort führte uns ein Postautobus nach Vilhelmina, einem kleinen Ort, der nicht so weit von der norwegischen Grenze liegt. Dort riefen wir bei einem uns bekannten Bauern an, der uns mit dem Auto abholte und zu seinem Gehöft brachte. Eigentlich ist das Wort Gehöft ein zu starker Ausdruck für das kleine Bauernhaus und den danebenliegenden Stall, aber unsere Wirtsleute waren einfache Menschen und zufrieden mit dem, was sie hatten. Der schmale, holprige Weg endete vor dem Haus. Abgesehen von ein paar Hektar Acker und Weideflächen für die sechs Kühe, umschloß uns der Wald. Bis zum Nachbarn ging ein schmaler Pfad einige Kilometer durch den Wald. Da er aber gar nicht so oft benutzt wurde, war er auch schon wieder ein wenig zugewachsen.
Die Bäuerin, eine gemütliche, dicke Frau, begrüßte uns mit herzlichem Händeschütteln, und sogar der Hund, ein schöner Collie, erkannte uns wieder und gab keine Ruhe bevor er meiner Frau die Hände abschlecken durfte. Wir wurden genötigt ein ausgiebiges Essen zu uns zu nehmen; jeder von uns bekam eine Portion Elchfleisch auf den Teller, die normalerweise wohl drei Tage gereicht hätte. Zum Nachtisch gab es frische Sumpfbrombeeren, diese Spezialität der Nordländer. Es sind dies gelbe Beeren, die ihrem Aussehen nach unserer Brombeere gleichen, aber nur in den Sümpfen der hohen Breitengrade Skandinaviens gedeihen. Da jedes Pflänzchen außerdem nur eine Beere hervorbringt und zudem noch recht unzugänglich ist, sind die Sumpfbrombeeren nicht nur eine Delikatesse, sondern auch eine Rarität.
Der Bauer besaß außer dem Gebiet um seinen Hof herum noch ein Stück Weide tief drinnen im Wald, wo früher ein Einsiedler gelebt hatte. In jungen Jahren, als unser Bauer noch Kräfte genug hatte um eine kleine Rinderzucht zu betreiben, hatte er beide Grundstücke bewirtschaftet. Die alte Einsiedlerhütte hatte er zu einem Stall für die Kälber und Färsen umgebaut, und da er nicht jeden Tag die fünf, sechs Kilometer hin und zurückgehen wollte, hatte er sich dort auch ein einfaches Blockhaus zusammengezimmert. Diese Hütte mieteten wir jetzt schon zum fünften Mal und bald nach dem Essen machten wir uns auf den Weg dorthin
Es war zwar schon Abend geworden, aber so hoch im Norden sind die Nächte im Sommer immer hell, sodaß wir keine Schwierigkeiten hatten, unser Domizil für die nächste Woche zu finden. Von der langen Reise ziemlich erschöpft, packten wir nur schnell unsere Dinge aus, bezogen die zwei Betten - einfache Holzgestelle, die übereinander standen, um Platz zu sparen - und legten uns schlafen.
Früh am nächsten Morgen weckte mich leises Knistern aus dem offenen Kamin und der Geruch von frischem Kaffee kitzelte in der Nase.
"Na, du Siebenschläfer", rief meine Frau hurtig, als sie sah, daß ich die Augen geöffnet hatte. "Willst du nicht aufstehen? Es ist gleich sechs."
Um sechs habe ich normalerweise gerade meine schönsten Träume, aber durch das kleine, viereckige Fenster an der einen Längswand lachte die Sonne ins Haus, und schließlich war ich ja nicht hierhergekommen um den Urlaub zu verschlafen.
Leider lachte die Sonne auch durch ein paar Fugen zwischen den groben Baumstämmen der Hüttenwände. Es war eben nur eine ganz einfache Behausung, die ja auch nicht für ständigen Gebrauch abgesehen war. Als ich mich aus den Decken wand, spürte ich, daß es in der Nacht ziemlich kühl gewesen sein mußte, und ich war froh, daß meine Frau schon Feuer gemacht hatte. Weiß Gott, wie sie das anstellte, bei meinen Versuchen gab es meist eine ganze Schachtel voll abgebrannter Streichhölzer, viele Schimpfworte und das ganze Haus voll von Rauch und Ruß.
Um nicht ganz auf die Zivilisation verzichten zu müssen, hatten wir einen kleinen Gaskocher mitgebracht, der mit seinen eifrigen, blauen Flammen schon den Kaffee gekocht hatte und jetzt Wasser für unsere Frühstückseier wärmte. Wir hatten uns Proviant für die halbe Woche mitgenommen, in drei Tagen wollte der Bauer uns Nahrungsmittel für die zweite Hälfte herbringen.
Die Einrichtung der Hütte war spartanisch. Außer den Betten und dem Garderobenschrank, mit zwei Fächern und ein paar Kleiderbügeln, gab es nur einen kleinen, selbstgebauten Tisch unter dem Fenster und zwei ebenso klobige Stühle.
Waschen mußten wir uns vor dem Haus unter einer alten Pumpe, die zwar herrlich klares, aber ebenso kaltes Wasser ausspuckte.Deshalb ging ich nach meiner flüchtigen Morgentoilette in den kleinen Schuppen neben dem Stall, wo zu Klötzen gesägte Baumstämme darauf warteten, zu Brennholz gehackt zu werden. Bei dieser Arbeit wurde mir ganz schön warm und ich war beschäftigt, während meine Frau unseren Rucksack mit belegten Broten für das Mittagessen fertig packte.
Dann schnappten wir jeder zwei Plastikkübel und machten uns auf die Beerensuche. Am frühen Nachmittag - wir hatten schon zwei unserer Eimer gefüllt - schrie meine Frau hinter mir plötzlich auf. Sie war im dichten Unterholz schlecht aufgetreten und hatte sich den Knöchel verstaucht. Wir setzten uns auf einen vom Sturm gefällten Baumstamm und versuchten nach einer Weile weiterzugehen, aber die Schmerzen waren so stark, daß meine Frau lieber umkehren wollte.
Ich schnitt ihr einen Stock zurecht und stützte sie so gut ich konnte, und so machten wir uns langsam humpelnd auf den Heimweg. Wohl oder übel mußten wir uns auch entschließen, einen der vollen Kübel zurückzulassen. Das war an und für sich nicht so schlimm, denn ich habe einen guten Orientierungssinn und würde daher den Kübel später leicht wiederfinden. Doch wie soll ich unsereÜberraschung beschreiben, als wir nach einer mühevollen Wanderung bei der Hütte ankamen und vor der Tür den Kübel, bis an den Rand mit den blauen Beeren gefüllt, wiederfanden.
"Das kann doch nicht sein", rief ich aus. "Der Bauer muß selbst Heidelbeeren gepflückt haben und hat einen Kübel hier abgestellt. Vielleicht wartet er auf uns drinnen."
Aber das Haus war leer. Und als meine Frau endlich auf einem Stuhl saß und ihr Bein ausruhen konnte, an dem der Knöchel nun ziemlich stark angeschwollen war, holte ich den gelben Plastikeimer ins Haus. Beim näheren Betrachten stieg meine Verwunderung aber aufs Neue.
"Schau", zeigte ich meiner Frau, "es ist unser Kübel. Hier, diese abgeschabte Stelle, an die erinnere ich mich genau."
"Aber das ist doch unmöglich", meinte sie. "Der Kübel kann doch nicht von selbst hierherkommen."
Wir rätselten noch eine gute Weile über das scheinbar Unerklärliche, dann fand meine Frau endlich eine Lösung, die uns befriedigte.
Der Bauer wird auch Beeren gesucht haben, und da hat er den Kübel gefunden. Er hat ihn natürlich hergetragen und uns dabei auf einem anderen Weg überholt, weil wir so langsam gehen mußten."
Ich fand es zwar sonderbar, daß wir sonst keine Spur von ihm entdeckt hatten, und daß er keine Notiz zurückgelassen hatte, aber es schien die einzig mögliche Lösung zu sein.
* * * * *
Am folgenden Morgen war nicht daran zu denken, daß meine Frau etwa in den Wald gehen könnte. Wir hatten zwar den Knöchel mit kalten Umschlägen behandelt, seit wir heimgekommen waren, und die Geschwulst war ein wenig zurückgegangen, aber eine Belastung hielt der Fuß noch nicht aus. Ich wollte meine Frau keinesfalls allein lassen, und wir debattierten während des Frühstücks lange darüber, was wir tun sollten, schließlich aber gewann sie die Oberhand.
"Mir hilft es doch überhaupt nichts, wenn du hierbleibst. Und dann bekommen wir auch keine Beeren. Das wäre nicht nur schade, sondern was würden unsere Wirtsleute dazu sagen?"
"Unsere Wirtsleute", entgegnete ich, "müssen doch einsehen, daß man, wenn man verletzt ist, nicht Beeren pflücken kann."
Unser Übereinkommen mit dem Bauern ging nämlich darauf hinaus, daß wir die Hälfte unseres Fundes als Bezahlung für die Hütte und das Essen abliefern sollten. Außerdem hatte sich die Bäuerin schon im zweiten Jahr dazu bereit erklärt, auch unseren Teil der Beeren zu Marmelade einzukochen, damit wir sie leichter heimtransportieren konnten. Es war also an sich ein gutes Geschäft für uns, aber die Voraussetzung war natürlich, daß wir auch wirklich Beeren pflückten.
"Sicher, aber verletzt bin ja nur ich", setzte mir meine Frau weiter zu. "Und wir haben doch gestern die Beeren ohnehin nicht gereinigt. Das könnte ich heute tun, während du unterwegs bist. Da ist mir dann auch nicht langweilig."
Ich fügte mich also. Und nachdem ich mich davon überzeugt hatte, daß es ihr an nichts fehlen würde, ging ich los.
Ich erwähnte anfangs, daß es ein Naturerlebnis ist, durch die endlosen Wälder von Nordland zu streifen. Aber wieviel stärker war doch das Gefühl jetzt, da ich die ganze Natur für mich allein hatte. Fast ehrfürchtig schlich ich zwischen den stolzen, dichten Tannen, an hohen, roten Kiefernstämmen vorbei. Weiße Birken, in allen möglichen, zierlich gekrümmten Stellungen säumten ein kleines Bachbett ein, in dem das Wasser erfrischend murmelte. Ich dachte daran, daß wir für solche Gegenden einen scherzhaften Ausdruck geprägt haben: wo der Fuchs und der Hase einander gute Nacht sagen. Aber ich hielt es gar nicht für so unwahrscheinlich, daß sie es hier wirklich taten, daß es hier keinen Jäger und keinen Gejagten gab, sondern beide in Eintracht mit der allmächtigen Natur lebten. Ich bemühte mich nahezu, nicht auf einen trockenen Ast zu treten, um nicht einen störenden Laut hervorzurufen.
Ich war auf eine Anhöhe hinaufgekommen und trat unerwartet auf eine Lichtung. Von hier hatte ich eine wundervolle, weite Aussicht. So weit ich meinen Blick auch richten mochte, vor mir erstreckte sich unendlicher Wald. Ich hockte mich auf einen Baumstumpf, um hier mein Schinkenbrot zu verzehren und so die Gegend ein wenig länger genießen zu können. Ich weiß nicht, wie lange ich in Gedanken versunken war; nein, ich saß ganz einfach dort, ohne Gedanken, eins mit dem Frieden um mich.
Da sah ich plötzlich den Gartenzwerg.
Er stand links von mir, am Rand der Lichtung. Er mochte einen knappen halben Meter hoch sein, hatte ein runzeliges Gesichtchen mit lustigen, seltsam lebhaften Augen. An den Füßen hatte er Sandalen aus Renntierpelz und am Kopf natürlich eine rote Zipfelmütze. Die Jacke war aus grauer Wolle und die verblichene, blaue Hose schlotterte um seine Knie. Aber halt! An einem Gartenzwerg kann doch die Hose nicht schlottern! Noch ehe ich den Gedanken richtig erfaßt hatte, hob er eine Hand.
"Hab keine Angst", piepste ein dünnes Stimmchen.
Ich kniff die Augen zu und öffnete sie schnell wieder. Er stand immer noch da.
"Ich tu dir nichts", sagte er. "Komm mit mir."
Ich rührte mich nicht, schüttelte nur ungläubig den Kopf.
"Komm mit mir", wiederholte er eindringlich.
"Wer bist du denn eigentlich?" Ich hatte mich von der ersten Überraschung erholt, eine Spur von Neugier begann in mir zu keimen.
"Ich bin Wunderlich, der Bergwächter."
"Aha. Wunderlich, der Bergwächter. Und was bist du?"
"Ich bin ein Tomte."
Ich mußte lächeln. Der Tomte ist der schwedische Cousin unserer Heinzelmännchen. Und die gibt es ja nur in Märchen. Der hier sah aber verblüffend echt aus. Ein wirklich wunderliches Zwerglein, es trug seinen Namen mit Recht.
"Was willst du denn eigentlich von mir?"
"Das darf ich nicht sagen. Komm mit mir."
Ich war halb versucht aufzustehen, aber die Sagen von verschwundenen Menschen, die ich gehört hatte, fielen mir ein und machten mich zögern. So setzte ich die Verhandlung fort:
"Wohin soll ich denn kommen?"
"In den Berg."
"In den Berg? Warum?"
"Du sollst uns helfen."
Langsam fand ich Gefallen an der Situation. Es überraschte mich ein wenig, einsehen zu müssen, wie schnell man dazu bereit ist, sogar eine Irrealität zu akzeptieren, wenn man sie einmal vor Augen hat. Ich zweifelte jedenfalls nicht mehr am Dasein dieses Wesens.
"Uns? Gibt es noch mehrere von deiner Sorte?"
"Natürlich." Das klang fast ein wenig beleidigt.
"Wenn ich euch helfen soll, warum kommt ihr dann nicht zu mir?"
"Das geht nicht. Nur ein Bergwächter darf bei Tageslicht von einem Menschen gesehen werden. Komm jetzt."
Nun war ich gelinde gesagt neugierig. Die Angst steckte zwar noch immer im Hintergrund, aber ich stand auf. Als könnte er meine Gedanken lesen, sagte er nochmals:
"Du brauchst keine Angst zu haben." Damit trippelte er mir voran, wohlbedacht meiner Größe, sodaß er nur Wege wählte, die auch ich ohne Hindernis begehen konnte. Ab und zu drehte er sich halb um, wie um zu sehen, daß ich ihm auch wirklich folgte. Es ging eine ganze Weile bergab. Erst nach ein paar Minuten merkte ich, daß ich meine beiden Kübel und den Rucksack vergessen hatte. Ich sagte es meinem kleinen Führer.
"Das macht nichts", antwortete er. "Du bekommst sie wieder."
Ich dachte, daß ich sie allemal selbst wiederfinden würde, bekam aber gleichzeitig ein sonderbares Gefühl. Wenn ich im Wald umherstreife, gebe ich normalerweise nicht besonders auf den Weg acht, sondern ich spüre irgendwie, in welche Richtung ich zurückgehen muß. Dieses Gefühl war aber auf einmal nicht mehr da. Ein Schauer lief über meinen Rücken, ich war nun wieder unsicher, verängstigt. Ich wollte gerade stehenbleiben und dem Wicht sagen, daß ich umkehren wolle, als er hinter einem großen Felsblock verschwand. Gleich darauf bewegte sich aber der Stein, rollte zur Seite und gab ein rundes Loch im Waldboden frei. Ein starkes Seil hing in das Loch hinab. Das Zwerglein bedeutete mir, daran hinunterzuklettern. Jetzt aber hatte ich wirklich Angst. Eine Welle der Panik durchfloß mich.
"Ich will nicht", sagte ich.
"Es wird dir nichts geschehen", versicherte er.
"Wer sagt mir, daß ich hier je wieder herauskomme?"
"Hab keine Angst", piepste er. Ihm fiel es leicht, das zu sagen... Aber er sprach schon weiter:
"Den Kübel mit den Beeren haben wir gestern für dich heimgetragen."
Hm. Ein Argument. Aber ein schwaches. Was hatte das eine mit dem anderen zu tun?
"Komm, hilf uns", meinte er wieder und begann am Seil hinunterzuklettern. Rasch beugte ich mich vor, aber er war schon zu weit unten, sodaß ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Da saß ich nun, das Loch im Boden vor mir.
"He, komm wieder herauf", schrie ich hinunter. Keine Antwort. Ich mußte natürlich nicht hinunterklettern. Ich konnte aufstehen und weggehen. Aber ich wußte, daß ich die Richtung verloren hatte. Natürlich schien die Sonne, was ein wenig Hilfe bedeutete. Denn so konnte ich wenigstens in einer geraden Richtung weitergehen und war sicher, nicht im Kreis zu laufen. Aber jede Richtung konnte ja nach Hause führen. Viel wahrscheinlicher führte sie aber nicht dahin, sondern irgendwohin in den grenzenlosen Wald. Verirrte ich mich hier, dann war es aus mit mir. Was heißt, ich hatte mich ja schon verirrt.
Ich fühlte Haß auf das kleine Männchen, auf mich selbst. Daß ich so leicht in die Falle gegangen war. Die einzige Möglichkeit, die mir blieb, war das Loch und die Hoffnung, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Mißmutig ergriff ich das Seil und ließ mich hinab. Etwa fünf Meter tiefer fand ich wieder Boden unter den Füßen. Im selben Augenblick rollte oben der Stein über die Öffnung. Aber es wurde nicht ganz dunkel. Ich befand mich in einem Schacht, der etwa einen Meter breit und doppelt so hoch war. Von den Wänden leuchtete ein grünlicher Schimmer, es mußte phosphorizierendes Licht sein. Meine Augen gewöhnten sich rasch daran und dann sah ich den Zwerg ein paar Meter vor mir.
"Gut, daß du gekommen bist", sagte er.
"Sag, was fällt dir denn eigentlich ein", brüllte ich und warf mich nach vorne, um uhn zu erreichen. Ich war wütend. Aber er wich geschmeidig ein paar Schritte zurück, sodaß meine Hand danebengriff.
"Nicht böse sein", sagte er entschuldigend. "Es war meine einzige Möglichkeit, dich hierherzubekommen."
Er beteuerte hoch und heilig, daß mir nichts geschehen würde, daß ich bald wieder frei wäre, wenn ich nur mitkäme, sodaß sie in Ruhe mit mir sprechen könnten. Ich beruhigte mich ein wenig, während ich seinen Beschwörungen zuhörte, und gleichzeitig regte sich wieder die Neugierde. Die ganze Situation war ja jetzt schon absurd, wie würde das wohl weitergehen?
"Also gut", entschied ich schließlich mit einem Seufzer. "Ich komme mit. Aber versuche es nicht nocheinmal mit irgendwelchen Tricks, denn dann geht es dir schlecht, wenn ich dich erwische."
Er versprach, daß mich keinerlei unliebsame Überraschungen mehr erwarten würden, vorausgesetzt, daß ich ihm gutwillig folgte. Dann begann er, mir in diesem grün beleuchteten Tunnel voranzugehen.
* * * * *
Während ich nun hinter dem Zwerglein einherschritt, versuchte ich aus der Situation das Bestmögliche zu machen und stellte Fragen an ihn, die das Leben und Wesen der Heinzelmännchen betrafen. Er wollte mir jedoch nicht antworten, sondern berief sich darauf, daß er keine Erlaubnis habe, mich über solche Dinge aufzuklären.
So trotteten wir also bald schweigend dahin und ich war auf meine Sinneseindrücke angewiesen, um mehr über meine Umgebung zu erfahren. Es war ein weiter Weg, der Tunnel verlief schnurgerade, wenn auch vielleicht etwas abschüssig. Bald merkte ich links und rechts auch Abzweigungen, die jedoch fast alle kaum die Hälfte so hoch wie unser Gang waren. Nach einer Weile glaubte ich Musik zu hören, liebliche Musik, wie wenn hunderte kleiner Glöckchen, genau aufeinander abgestimmt, eine bezaubernde Melodie spielten. Das Spiel der Glöckchen wurde bald lauter, bald leiser, verschwand aber ganz, als wir jetzt in rascher Folge ein paar Mal links oder rechts abbogen.
Ich fragte mich im Stillen, ob der Zweck dessen nur war, mich irrezuführen, sodaß ich keinesfalls den Weg zurückfinden konnte. Bei dem Gedanken daran mußte ich unbewußt langsamer gegangen sein, denn mein kleiner Führer trippelte plötzlich ein gutes Stück vor mir. Als könnte er auch nach hinten sehen, blieb er gleich darauf stehen und wartete auf mich. Ich wollte von ihm den Grund unserer Abweichmanöver wissen, und überraschenderweise war er zu einer Antwort bereit.
"Du mußt verstehen, daß wir viele Feinde haben, obwohl wir niemand etwas zuleide tun. Und deshalb müssen wir uns schützen, so gut wir können. Wir gehen jetzt wieder im selben Gang wie vorhin, aber es wäre nicht ratsam, den Weg gerade zurückzugehen."
Schön. Das war Diplomatie. Er erklärte es als Schutzmaßnahme, deutete aber indirekt an, daß ich mit meiner Vermutung doch recht gehabt hatte und daß ich mich immer tiefer in ihre Gewalt begab. Ich wollte wissen, wen sie als Feind bezeichneten.
"Nun, vor allen Dingen die Trolle, aber es gibt auch viele schlechte Menschen, die uns nachstellen", erklärte er.
Trolle, das sind kleine Unholde, Heinzelmännchen im negativen Sinn, sozusagen. Sie sollen eigentlich nicht von Natur aus böse sein, aber durch ihre Leichtsinnigkeit und ihren Übermut viel Unfug anstellen. Aber Mensch war schließlich auch ich.
"Wieso weißt du denn, daß ich euch nicht nachstellen werde, ich bin doch auch ein Mensch." Und ich fügte hinzu: "Grund genug dazu hätte ich wirklich."
"Du bist aber kein schlechter Mensch, sonst hätten wir dich nicht gebeten, uns zu helfen."
Das war Honig in meinen Ohren und ich wollte gerade anfangen auf mich stolz zu sein, als er weitersprach.
"Du bist zwar ein wenig faul und ziemlich jähzornig, aber dein Wille ist gut."
Mag der Wille fürs Werk gehen, dachte ich und fragte:
"Woher wollt ihr denn das wissen?"
"Das darf ich dir nicht sagen." Punkt. So einfach war das. Aber es schadete der Konversation, denn nun gingen wir wieder schweigend dahin. Auf jeden Fall hatten diese Leutchen ein ganz schön ausgebautes Straßennetz. Ich sah auf meine Uhr. Halb zwei. Vorausgesetzt, daß wir an der Erdoberfläche eine halbe Stunde palavert hatten, marschierten wir schon eine volle Stunde durch diesen Gang. Ich versuchte es wieder.
"Ihr habt dieses Gangsystem aber ganz schön ausgebaut. Gibt es viele solcher Tunnels?"
"Ja."
"Wieviele?"
"Sehr viele."
"Sind wir tief unter der Erde?"
"Das darf ich dir nicht sagen." Puh. Schon wieder.
"Und wenn du es mir trotzdem verrätst?"
"Ich sage es aber nicht."
Ich blieb stehen. Er auch. Ich sammelte meine Beherrschung, dann erklärte ich ihm so ruhig wie möglich:
"Du brauchst es mir nicht zu sagen. Aber was würde geschehen, wenn du es mir erzähltest?"
Er sah ein wenig ratlos drein, während er nachdachte. Dann zuckte er mit den Schultern.
"Die anderen würden traurig sein, weil ich ein Geheimnis verraten habe."
"Was würden sie mit dir tun?"
"Tun? Ich weiß es nicht."
Ich schüttelte unwillig den Kopf, während wir langsam weitergingen. Wollte er nicht verstehen?
"Aber was geschieht mit anderen, die Geheimnisse verraten?"
"Es gibt keinen Tomte, der Geheimnisse verrät."
"Habt ihr keine Kinder?"
"Doch."
"Nun, und wenn ein Kind aus Versehen ein Geheimnis preisgeben würde?"
"Das geht auch nicht", behauptete er sicher. "Schau, wir werden sehr alt. Etwa zweihundert eurer Jahre. Und da haben wir viel Zeit, unsere Kinder zu erziehen. Bevor sie nicht groß genug sind, um zu verstehen, daß es über uns alle Unglück bringen könnte, wenn sie versehentlich etwas ausplaudern, haben sie ganz einfach keine Gelegenheit dazu. Und wenn sie einmal erwachsen sind, dann haben sie auch Verantwortung genug, um nicht darüber zu sprechen. Niemand von uns würde jemals etwas erzählen, was man nicht sagen darf, genauso wie niemand etwas tun würde, was man nicht tun darf."
Langsam ging mir auf, daß ich es war, der nichts verstand. Aber war es denn möglich? Konnte es denn wirklich eine Gesellschaft geben, die moralisch so hoch stand? Andererseits war es natürlich genauso unmöglich, daß es solche Wesen überhaupt gab. Und trotzdem unterhielt ich mich mit einem von ihnen. Ein anderer Gedanke tauchte auf. Wie sollte ich ihnen helfen können, wenn das wirklich alles stimmte, was Wunderlich mir erzählte? Würden wir nicht viel eher ihre Hilfe brauchen?
Ich war so in meine Gedanken versunken, daß ich erst gar nicht merkte, daß sich das Aussehen unseres Ganges verändert hatte. Die Wände waren nun aus Brettern gezimmert und das grüne Licht war elektrischen Lampen gewichen. Wenigstens ließen mich die kleinen Lämpchen, die etwa alle zehn Meter an der Wand hingen, an elektrischen Strom denken. Nur schienen sie viel heller zu leuchten als unser künstliches Licht. Aber vielleicht kam das daher, daß sich meine Augen an das relative Dunkel gewöhnt hatten, das bisher vorgeherrscht hatte.
"Jetzt sind wir bald da", meinte mein Begleiter. Die lange Wanderung und unser letztes Gespräch hatten dazu beigetragen, daß ich ruhiger geworden war, daß ich kaum noch Angst hatte. Jetzt war ich hauptsächlich darauf gespannt, was eigentlich der Sinn meiner Entführung sein sollte.
Der Boden, bisher aus hartem Gestein, bestand nun aus festgetretener Erde und die Abzweigungen von dem langen Gang waren durch Türen verschlossen. Es war niedlilch, diese Türchen zu sehen, die ja in der Größe dem Zwergenvölkchen angepaßt waren. So waren etwa die Türschnellen kaum größer als mein kleiner Finger und ungefähr in der Höhe meiner Knie angebracht.
Endlich nahm der Gang ein Ende. Eine normalgroße Tür versperrte uns den Weg, aber auch an ihr war der Türgriff in Kniehöhe. Wunderlich drückte die Klinke nieder und schob die Tür auf.
Wir traten in einen kreisrunden Saal, aus dem noch weitere vier normale und zwei kleine Türen wegführten. Ehe ich jedoch Zeit hatte, mich genauer umzusehen, deutete mein Wegweiser auf einen Stuhl und sagte:
"Setz dich und warte. Ich komme wieder um dich hinauszuführen, wenn es Zeit ist."
Damit ging er und ich war allein.
* * * * *
Der Stuhl, auf den ich mich setzte, war reich verziert und sicherlich sehr wertvoll, aber das Tischchen daneben verschlug mir den Atem. Es war ganz aus Steinen gefertigt und die Platte aus vielen kleinen Quarzsteinchen zusammengesetzt. Amethyst, Rosenquarz, Citrin und Rauchquarz bildeten ein herrliches Muster, das außerdem von einer darunterliegenden Lampe beleuchtet wurde. Auf dem Tischchen stand eine Kristallschale voller herrlichen Früchten. Ich bediente mich, denn ich nahm an, daß sie dazu hergestellt worden waren. Während ich an einem großen Pfirsich lutschte, sah ich mich genauer um.
Der Saal mochte etwa sechs Meter Durchmesser haben und etwa zwei Meter hoch sein. Die Vertäfelung der Wände war aus lichtem und dunklem Holz so geformt, daß sie zwischen je zwei Türen ein sternförmiges Muster zeigte.
Von dem Stuhl, auf dem ich saß, abgesehen, gab es noch zwei in Menschengröße, und außerdem mitten im Zimmer eine Sitzgruppe in Kleinformat. Die winzigen Möbel waren kunstvoll geschnitzt; die Beine stellten ausnahmslos Wildtiere dar, während die Rückenlehnen mit Landschaftsbildern bemalt waren. Es wunderte mich ein wenig, daß sie sechs so verschiedenartige Landschaften zeigten. Die eine mochte etwa dem Anblick entsprechen, den ich heute von der Lichtung aus genossen hatte. Eine zweite wies ohne Zweifel eine Meeresküste, die nächste ein wallendes Getreidefeld. Die anderen drei waren exotischer. Da gab es eine arktische Landschaft, eine weiße Wüste, daneben sah man einen Gletschergipfel und zuletzt war da noch ein Urwald dargestellt, wie man ihn nur in den Tropen findet.
Ich hatte jedoch keine Gelegenheit mehr, weitere Gedanken darüber zu verlieren, denn eine der kleinen Türen ging auf und vier Wichte kamen ins Zimmer. Alle waren in derselben Art gekleidet, wie schon Wunderlich es gewesen war, nur waren ihre Jacken nicht grau, sondern rot.
Als sie so hintereinander hereingetrippelt kamen, konnte ich zunächst überhaupt keinen Unterschied zwischen ihnen feststellen, sie hätten gern Wunderlichs Zwillingbrüder sein können. Drei von ihnen setzten sich, der vierte blieb stehen und wendete sich an mich.
"Es freut uns, dich hier zu sehen", sagte er zur Begrüßung und deutete eine Verbeugung an. Dann nahm auch er Platz.
"Wir vier sind die Vertreter unseres ganzen Volkes", fuhr er fort, "und wenn du unsere Worte hörst, dann denke daran, daß es eine große Anzahl ist, für die wir hier sprechen. Außerdem sollst du wissen, daß du nicht der Einzige bist, der heute zu uns gerufen wurde. Auf der ganzen Welt treffen wir zu dieser Zeit Menschenwesen, denen wir dasselbe sagen, wie dir.
Es gehört nicht zu unseren Gewohnheiten, mit euch direkt in Verbindung zu treten, doch die Lage ist so ernst, daß wir dazu gezwungen sind."
Aus seiner Hosentasche holte er einen ovalen Gegenstand, den er vor sich auf die Tischplatte legte. Das Ding glich etwa einem Taubenei, abgesehen davon, daß es dunkelrot gefärbt war.
"Wir möchten dir etwas zeigen, das besser ist, als Worte es je sein können. Dazu müssen wir aber das Licht löschen. Hab keine Angst, es geschieht dir nichts."
Zu seinen letzten Worten begann die Beleuchtung schwächer zu werden, etwa wie im Kino oder im Theater. Gleichzeitig merkte ich, wie das Ding auf dem Tisch zu leuchten anfing. Erst war es ein rötlicher Schimmer, der sich auf dem Tisch ausbreitete, aber als es schließlich ganz dunkel geworden war, war der ganze Saal in mattrotes Licht getaucht, das von diesem merkwürdigen Gegenstand ausging, der nun selbst in unsagbarer Schönheit strahlte.
"Mach jetzt die Augen zu", befahl ein anderer Zwerg und ich gehorchte.
In meinem Gehirn formte sich ein Bild und wie auf einer Leinwand begann ein Film abzulaufen. Es begann mit der Meeresküste, die ich soeben auf einer Stuhllehne bewundert hatte. Wie von einer Kamera gesteuert bewegte sich das Bild aufs offene Meer hinaus. Weit draußen am Horizont konnte ich nun einen schwarzen Punkt erkennen und es dauerte nicht lange, bevor ich ihn als Schiff ausmachen konnte. Es war einer der enormen, flachen Öltankschiffe, mit dem verhältnismäßig kleinen Aufbau am Heck, von wo aus diese Riesen gesteuert werden. Der Supertanker lag wie ein Brett im Wasser, seine Bewegungen allerdings erschienen ungewöhnlich. Nur der Bug hob und senkte sich ein wenig im Wasser, sonst lag das Schiff am gleichen Fleck.
Ununterbrochen näherte sich meine unwirkliche Kamera dem Platz. Und als wir endlich über dem Tankboot hielten und ihn aus Vogelperspektive betrachten konnten, sah ich, daß das Wasser ringsum schwarz war. Es war eines der unzähligen auf Grund gegangenen Öltransportschiffe, an die wir uns schon so gewöhnt haben, daß wir die Nachricht davon nur mehr mit einem Achselzucken hinnehmen.
Plötzlich kam ein Schnitt in dem Film und wir befanden uns wieder an der Küste. Aber wie sah es hier anders aus! Der Sandstrand war von schwarzen Flecken übersät, die in fettigen Brocken umherlagen. Überall gab es tote Vögel, die Flügel von dieser zähen Masse verklebt. Links im Bild hatte die Brandung das Öl auf eine vorspringende Felsenwand geworfen. Tang und Algen hingen in bizarren Formen von den Steinen herab, wie schmierige Ölfetzen.
Ehrlich gesagt fand ich das Gesehene wohl ein wenig unangenehm und traurig, aber es war eben ein Alltagsbild, wie man es im Fernsehen zu sehen bekommt, und es konnte mich nicht so sehr erschüttern.
Als das Bild aus meinem Kopf verschwand und ich die Augen geöffnet hatte, sah ich zu den vier kleinen Wesen hinüber. Mich interessierte vor allem, wie sie die Vorstellung bewerkstelligt hatten. Auf meine diesbezügliche Frage schien es mir, als ob sie meine Reaktion geringschätzten, aber ich bekam auf jeden Fall Antwort.
"Das ist schwer zu erklären", meinte der, der zuerst gesprochen hatte. "Du kannst es vielleicht Gedankenübertragung nennen, was für eure Begriffe am nächsten kommt. Eigentlich ist das aber gar nicht so wichtig. Mach wieder die Augen zu."
Unwillkürlich gehorchte ich, im selben Augenblick aber ging es mir durch den Sinn, daß seine Antwort ziemlich schroff gewesen war. Ich wollte ihm gerade sagen, daß er doch ein wenig höflicher sein könne - doch ich bekam weder einen Laut hervor, noch konnte ich die Augen wieder öffnen. Vor mir entstand schon das nächste Bild. Es war dies die Waldlandschaft.
Wieder gingen wir von einem Panoramabild aus, ich sah die Unendlichkeit grüner Bäume und ein Flugzeug, das in geringer Höhe über den Wipfeln kreiste. Wir bewegten uns abermals vorwärts und bald sah ich weißliche Schwaden hinter dem Flugzeug zu Boden sinken. Auch das war keine Neuigkeit, ich wußte sofort, daß es sich hier um Unkrautbekämpfung handelte, damit das Gestrüpp zwischen den Bäumen nicht allzu wild wachsen sollte.
Jetzt verschwand das Flugzeug und ich konnte statt dessen ein Detailbild sehen. Wir befanden uns in einem sehr lichten Wald. Hohe, rote Kiefernstämme ragten in gleichmäßigen Abständen vom Boden empor. Ein Traumanblick für einen Holzfäller. Doch zwischen den Kiefern gab es kaum Leben. Dürres Gebüsch mit braungebrannten Blättern stand ringsum, der Boden war trocken, unfruchtbar. Ein toter Fuchs lag langgestreckt am Ufer eines kleinen Wildbaches, dessen lebendiges Wasser fast gespenstisch von der Umgebung abstach. Dann wurde es wieder dunkel.
Ich sah meine Gastgeber an, doch diesmal sagte ich nichts. Vermutlich hatte ich vergessen, daß ich sie soeben noch zurechtweisen wollte, oder aber war es so, daß mir die Bilder die Lust daran genommen hatten. Langsam begann ein Gedanke in mir zu keimen. Ich fing an zu ahnen, worauf sie hinauswollten. Es konnte, es mußte wohl so sein, daß dieses Zwergenvölkchen durch unsere fortgeschrittene Technologie viel zu leiden hatte. Vermutlich wurden sie von diesen Giften viel stärker betroffen, als wir Menschen.
"Ich sehe, du beginnst ein bißchen zu verstehen." Diesmal sprach das Männchen, das ganz links am Tisch saß. "Vielleicht sollten wir uns ein wenig darüber unterhalten?"
Während er sprach, klang das rote Glühen langsam ab und wurde durch die ursprüngliche Beleuchtung ersetzt.
"Ich weiß nicht, worüber wir uns unterhalten sollten." Ich schüttelte den Kopf. "Es ist zwar bedauerlich, daß diese Dinge geschehen, aber es ist unvermeidlich. Es ist immer schon vorgekommen, das Schiffe auf Grund gelaufen sind. Und das Öl brauchen wir eben. Wir müssen doch heizen. Und wir verwenden es in der Industrie. Da kann man doch gar nichts dagegen tun."
"Doch, man könnte schon", widersprach der erste, der der Anführer zu sein schien. "Aber lassen wir das einstweilen. Du hast begriffen, daß alle Umweltverschmutzung uns viel stärker zu schaffen macht, als euch. Das ist leider nur zu wahr. Wir haben früher auf der ganzen Erde unser Auskommen finden können. Das geht heute nicht mehr, sondern wir haben uns sehr anpassen müssen. Es gibt heute für uns nicht mehr viele Plätze, wo wir überleben können. Und vielen Tieren geht es genauso....."
Er ließ die Worte in der Luft hängen und spielte gedankenverloren mit dem roten Ding auf dem Tisch, das fast so groß war wie seine Faust. Jetzt erst merkte ich, daß die vier einander doch nicht so ähnlich waren, wie ich zuerst gedacht hatte. Obwohl alle runzelige, alte Gesichtchen hatten, konnte man doch deutliche Merkmale sehen, die sie unterschieden. Der Anführer hatte zum Beispiel viel schärfere Linien um die Nase und den Mund. Und der Kerl rechts neben ihm hatte eine Schramme vom linken Ohr bis hinauf an die Zipfelmütze.
Ich fühlte Mitleid mit den kleinen Wesen, aber sie hatten sich an den Falschen gewendet. Ich würde ihnen kaum helfen können. Sie hätten sich wohl besser die führenden Politiker und Industriellen unserer Welt hergeholt. Aber sogar die würden nicht helfen können, wir saßen allzu fest im unserem Geschirr, wir konnten nur mehr geradeaus, kaum mehr seitlich abschwenken, geschweige denn zurück. Ich kam aber nicht dazu, meine Gedanken auszusprechen, denn das Zwerglein setzte fort:
"Es geht, wie gesagt, gar nicht nur um uns. Wir können uns einstweilen noch helfen. Aber du hast ja gesehen, wie ihr Menschen den Tieren zu Leibe rückt. Viele von ihnen haben bald keine Chance mehr, und müssen aussterben. Und das ist nicht gut so. Denn auch sie haben ihren Platz auf der Erde und das Recht zu existieren."
"Gut, aber dieses Recht müssen wir Menschen doch auch haben", verteidigte ich mich. "Und wir brauchen Energie, um überleben zu können. Wir wollen nicht erfrieren. Wir müssen das Öl transportieren, damit wir hier im hohen Norden überhaupt leben können, zum Teufel nochmal. Wir wollen auch nicht untergehen."
"Nein, das verlangen wir ja auch nicht", unterbrach mich der ganz links sitzende Zwerg. "Aber es ist ja nicht nötig, rücksichtslos Verderben zu streuen, nur um Profit zu schlagen, hohen Profit, höher als früher, noch höher, immer neue Rekorde brechend, den Standard immer höher schraubend." Sein Stimmchen klang böse und schrill. "Man muß auch anderes Leben achten, auch wenn es teurer kommt und nicht so schnell geht. Man kann die Natur ausnützen, statt sie zu zerstören. Wir haben die Sonne, den Wind, die Wellen im Meer. Und wir haben auch das Öl und den Wald. Aber nicht um jeden Preis. Man braucht den Wald nicht mit Gift zu bestreuen, das Gebüsch kann man auch mit der Axt weghacken."
"Aber ist es nicht ein Naturgesetz seit ewigen Zeiten, daß der Stärkere sich durchsetzt, auf Kosten schwächerer Arten?" Auch ich hatte die Stimme erhoben, wollte diese Beschuldigungen nicht wahrhaben. "Ist es nicht natürlich, daß wir danach streben, besser leben zu können, höheren Standard zu erreichen?"
"Nein", piepste es zurück. "Ihr Menschen beschränkt euch ja nicht mehr auf natürliche Mittel in diesem Wettbewerb der Arten, wie du es darstellst. Ihr verwendet doch Giftstoffe, die schließlich auch euch zerstören werden. Das, was ihr Standard nennt, ist grenzenloser Übermut. Es ist doch nicht nötig, alles Lebende mit Blei zu vergiften, nur weil jeder sein Auto fahren muß. Das bringt euch doch keine Vorteile. Ihr könntet Verkehrsmittel haben, die euch alle schneller ans Ziel bringen und die auch viel weniger Unfälle verursachen würden. Nennt ihr es Standard, wenn sich eure Art selbst fremd wird? Wenn jeder selbst genug hat, sodaß er sich nicht mehr mit anderen abgeben muß? Er merkt es erst, wenn er einen anderen braucht, aber keiner da ist, der sich um ihn kümmert. Bedeutet die Einsamkeit, unter der ihr leidet, den Standard, den ihr anstrebt? Das Mißtrauen, der Neid, die Angst dem Nachbarn gegenüber?"
Der Anführer erhob die Hand, um meinen Widersacher zu dämpfen. Jetzt sagte er einlenkend:
"So hat das keinen Sinn. Wir möchten dir lieber noch ein wenig mehr zeigen, dann wirst du besser verstehen."
Das Licht schwand und der rote Schein breitete sich wieder aus. Während dem Lichtwechsel brütete ich vor mich hin. Ich war zornig, denn ich fand es anmaßend von ihnen, mich und die ganze Menschheit auf diese Art zu beschimpfen. Auf der anderen Seite mußte ich zugeben, daß einige Dinge, die er erwähnt hatte, doch Hand und Fuß hatten. Aber trotzdem!
Ich würde mich von nun an zurückhalten, weil ich hoffte, daß sie mich so am schnellsten wieder gehen ließen. Und dann war die Sache für mich erledigt. Ich schloß also wieder meine Augen und wartete auf das nächste Bild. Es dauerte nicht lange, bis mir das Weizenfeld erschien.
Es war eines jener unglaublich großen Felder, wie man sie etwa in der Ukraine findet. Ein gelbes Meer breitete sich aus, die vollen Ähren schwangen wogend im Wind. Es war ein schöner, ein beruhigender Anblick. Ich jedoch war noch immer böse und hatte keine Lust, mich beruhigen zu lassen. Wieder schalt ich mich selbst, daß ich so leicht hereingefallen war. Das hatte ich nun davon. Ein plötzlicher Schnitt im Film ließ mich zusammenzucken.
Ich sah dieselbe Landschaft im Spätherbst. Gigantische Traktoren pflügten das Feld und hinter ihnen streuten machanische Verteiler Kunstdünger aus. Dann kam wieder das Bild mit reifem Getreide. Und dann wieder die Bodenbearbeitung. Die Bilder wechselten einender in rascher Folge ab. Immer wieder. Ich nahm an, daß man damit eine Folge von Jahren andeuten wollte. Ich weiß nicht genau, wie oft diese beiden Szenen wechselten, denn an sich war mir ja die ganze Sache egal, aber wenn ich heute schätzen müßte, könnten es vielleicht zwanzig Jahre gewesen sein, die auf diese Art vorüberzogen. Dann blieb der Film wieder stehen.
Wieder war es Sommer, der Weizen nahezu reif, doch welch ein Unterschied zum ersten Anblick. Der einst prächtige Acker brachte nun kaum die Hälfte des damaligen Ertrages, so dünn war die Saat aus der Erde gekommen. Und auch die Ähren waren kümmerlich anzusehen, jede trug nur ein paar Körner.
Noch immer war ich viel zu trotzig, um auf den Gedanken einzugehen, den man mir hier aufzwingen wollte. Aber das Bild wich nicht, und schließlich rührte sich in mir leise die Vernunft. Was, wenn es tatsächlich so kommen sollte? Wir hatten heute schon genug Ernährungsprobleme auf der Welt. Aber - das war doch lächerlich. In zwanzig Jahren, das war doch eine halbe Ewigkeit für unsere Technologie, um die Probleme zu lösen.
Die Zwerge mußten wohl wirklich meine Gedanken lesen können, denn als ich so weit gedacht hatte, begann die Vorführung wieder. Das Bild wechselte wie zuvor, nur war ich jetzt darauf vorbereitet und zählte mit. Ich kam auf fünfzehn Jahre. Und nun bemerkte ich die Veränderung auch gradweise. Nach etwa der halben Zeit, also in nicht ganz dreißig Jahren, von heute an gerechnet, hörte man auf, den Boden für die Landwirtschaft zu bearbeiten. Der Ertrag war wohl zu gering geworden, um noch lohnend zu sein. Am Ende dieser Wechselsequenz war wieder Sommer. Vor mir lag Steppenland, spärlich mit Gras bewachsen.
Ich fühlte mich ein wenig beklommen und gar nicht mehr so aufgebracht, wie noch vor ein paar Minuten.
"Laß die Augen zu", befahl mir einer der Wichte. Ich hörte es nur unbewußt, denn ich beschäftigte mich noch immer mit dem eben Gesehenen. So weit durfte es natürlich nicht gehen. Aber wir hatten ja noch genügend Zeit, hatten noch jede Möglichkeit, die Zeit für Forschung auszunützen. Vielleicht würden wir uns in Zukunft wirklich ganz auf chemischem Weg ernähren können, auch wenn das nicht gerade das höchste der Gefühle wäre.
Da begann es wieder zu flimmern, der Urwald erschien. Südamerika, war meine erste Assoziation. In einem Flugbild glitten wir über tiefgrüne Wälder, die sich bis zum Horizont ausdehnten. Meine innere Kamera landete schließlich irgendwo mitten im Dschungel. Es war auf einer Lichtung, wo man den Wald abgeholzt hatte. Baumstämme von riesigen Ausmaßen lagen kreuz und quer umher, und ein Stück weiter weg sah ich eine Maschine einen weiteren Baum fällen. Das Ding arbeitete unwahrscheinlich schnell. Im Nu lag der ganze, zwanzig Meter hohe Baum am Boden, wurde von einem Kran auf eine Bank gehoben und dort entästet. Gleichzeitig wurde die Rinde abgeschält und der nackte Stamm wurde nachher wieder zu Boden geworfen. Das Stahlungeheuer rollte zwei Schritte vor und begann schon den nächsten Baum zu attackieren. Und all das bewerkstelligte eine einzelner Mann, der in der Kanzel saß und mitten in der Arbeit noch Zeit fand, eine Zigarette zu rauchen. Es war schon toll, was wir heute mit unserer Technik alles vollbringen konnten! Das Ding schaffte leicht dreißig Bäume in der Stunde. Und es waren nicht gerade Zündhölzer, die da umgelegt wurden. Für diese Arbeit hätte früher ein Mann ein paar Tage gebraucht, trotz damals moderner Motorsägen. Und da hätte er wahrlich keine Zeit gehabt, während der Arbeit zu rauchen.
Wieder wechselten die Jahreszeiten, wieder mochten etwa dreißig Jahre vergehen. Ich wurde im Film wieder vom Boden emporgehoben und sah das Land unter mir. Der Urwald, das grüne Meer, war weg. Große Flächen verkarsteten Bodens klafften offen wie eitrige Wunden auf zernarbter Haut. Nur an einigen Stellen hatte die Natur es zuwege gebracht, ein bißchen Vegetation aufrecht zu erhalten.
Wir flogen jetzt einer Stadt zu, einer recht großen Stadt, schien es mir, die auf einem Hochplateau belegen war. Als wir nahe genug waren, um Details sehen zu können, lief es mir eiskalt über den Rücken. Die Stadt war leer, verlassen, tot. Kein Lebewesen war zu sehen, es nahm sich gespenstisch aus. Dann wurde es dunkel.
"Was ist denn hier geschehen?" Ich stieß die Frage hervor, noch immer erschrocken über diese unerwartete Entwicklung des Films. "Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?"
Der Anführer der Wichte übernahm die Antwort.
"Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, wenn ihr Menschen weiterhin die Natur mißbraucht. Das, was Du eben gesehen hast, war La Paz, die Hauptstadt Boliviens. Die Stadt liegt 3700 Meter hoch und wenn der Regenwald als Sauerstoffspender wegfällt, wird diese Stadt unbewohnbar, wie viele andere auch, weil die Luft zu dünn wird und nicht mehr genug Sauerstoff enthält."
Ich sagte nichts. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich dachte daran, daß wir heute schon an Überbevölkerung litten, daß wir in dreißig Jahren vielleicht doppelt so viele Menschen sein würden, die auf unserer Erde leben mußten. Die Gleichung um den Lebensraum ging nicht auf, nicht einmal mit den heutigen Verhältnissen.
Ich merkte kaum, daß der rötliche Schein schon wieder zunahm. Ich mußte auch automatisch die Augen geschlossen haben, denn auf einmal lag die arktische Landschaft vor mir. Doch nur einen kurzen Augenblick lang sah ich die Schneewüste, dann veränderte sich das Bild. Ich sah eine Großstadt, eine Industriestadt. Aus hunderten Schornsteinen quoll schwarzer, dicker Rauch, der in Schwaden über der Stadt hängen blieb, sodaß die Morgensonne über den Häuserdächern hinter dem grauen Qualm nur als große, rote Scheibe zu erkennen war.
Die Kamera glitt höher und höher, aber auch in den höheren Luftschichten konnte ich noch sehen, daß die Luft verschmutzt war. Dann kam ein Trickbild. Es zeigte ein Thermometer, ein Ding mit einer sehr feinen Skala, die sogar Zehntelgrad anzeigte. Dieses Thermometer begann zu steigen. Ein Zehntel, zwei, vier, sieben Zehntel, ein Grad, ein komma sechs Grad.
Ich begriff schließlich, daß man damit sagen wollte, daß die Temperatur unserer Atmosphäre langsam anstieg, bedingt durch die Abgase, bedingt durch den Treibhauseffekt der Luftverschmutzung.
Wieder kam ein neues Bild. Es zeigte eine Schärenwelt, das heißt eine Gruppe kleiner Inseln, wie man sie zum Beispiel in der Ostsee findet. Dann kam wieder die arktische Szenerie, die ich anfangs gesehen hatte. Und dann wieder die Schären, und wieder das Anfangsbild.
Das Bild wechselte hin und her, bis ich endlich den Zusammenhang begriffen hatte. Aber die Schlußfolgerung war so unglaublich, daß ich die beiden Bilder wohl an die fünfzig Mal abwechselnd sehen mußte, bevor mir ein Licht aufging. Es war genau dieselbe Ansicht, die ich sah. Nur zeigte das arktische Bild unsere heutige Zeit, die Schäreninseln dagegen die Zeit, in der es ein paar Grad wärmer geworden war. Der Schnee und das Eis waren ganz einfach weggeschmolzen.
Als ich mit meiner Gedankenfolge endlich so weit gekommen war, sah ich ein letztes Bild, das man allerdings nicht näher erklären brauchte. Vielleicht war es dieselbe Industriestadt wie vorhin, doch nun ragten nur noch die vielen Schornsteine und die oberen Etagen der Häuser in den Himmel, alles andere war von Wasser überflutet. Es war schlimm, diesen Anblick zu ertragen, doch logisch genug, denn all dieses Schmelzwasser mußte ja den Meeresspiegel beträchtlich anheben. - Und dadurch ging noch mehr Lebensraum für die Menschheit verloren. Das wäre Wahnsinn. Ein zu hoher Preis für den Fortschritt.
Aber schon kam die nächste Bildsequenz, nach den Stuhllehnen zu schließen mußte das die letzte sein. Zuerst der Gletscher, rings umgeben von einer sagenhaft schönen Bergwelt. Daraufhin kam, der Kontrast war himmelschreiend, ein Atomkraftwerk. Eine Reihe von Bildern zeigte die Verkapselung von ausgedientem Brennstoff. Dann ein Lastwagen, der die Kapseln wegfuhr. Wieder in den Bergen angelangt, zeigte man einen riesigen Hohlraum im Berginneren, wo anscheinend tausende solcher Kapseln verwahrt wurden. Endlagerung, nennen wir das, weil wir keine besser Lösung gefunden haben.
Schließlich sah ich wieder das erste Bild. Majestätisch ruhte der Gletscher vor mir. Der Film ging ins Detail und zeigte ein kleines Dorf eines der umliegenden Berge. Es war ein idyllisches Bauerndorf mit friedlichen Höfen und einer Dorfkirche.
Plötzlich begann der Kirchturm zu wackeln. Fenster gingen entzwei, Balken fielen von den Dächern, die Wand eines Hauses ging in Trümmer. Ein Erdbeben verheerte das Idyll.
"Oh Gott, die Brennstoffkapseln", zuckte es mir durch den Kopf.
Gleich darauf kam der Gletscher ins Bild zurück. Es schien mir, als ob sogar seine Spitze schwanken würde, doch das war natürlich nicht möglich. Doch nein! Der ganze Berg stürzte zusammen. Und dann explodierte mein Kopf. Wenigstens vermeinte ich es so zu spüren. Aber eigentlich war es nur Chaos.
Einige Kapseln mußten beschädigt, die kritische Masse erreicht worden sein, eine neue Kettenreaktion begonnen haben. Und das bedeutete wohl früher oder später das Ende für alle, für uns alle, die gegen die Radioaktivität nicht immun waren.
Ich öffnete die Augen. Die Zwerge sahen mich an und ich nickte ihnen stumm zu. Ich hatte verstanden. Es gab keine Argumente mehr. Wir, wir Menschen mußten umdenken. Schnell. Schnellstens.
Erst als der rötliche Schein ganz verschwunden war und die normale Beleuchtung den Saal erhellte, sprach der Anführer.
"Ich glaube, wir brauchen nichts mehr zu sagen. Du siehst jetzt, auch du mußt dazuhelfen."
Ich schlug mit den Armen aus, machtlos.
"Wie soll ich euch helfen können? Ausgerechnet ich? Wie denn?"
"Das wirst du schon sehen." Er nahm das rote, eiförmige Ding und trippelte auf mich zu. "Nimm den Stein. Er wird wieder leuchten, wenn du getan hast, was in deiner Macht steht. Du wirst schon das Richtige tun. Natürlich kannst du allein nicht die Welt verändern, aber du mußt deinen Beitrag leisten."
Ich schüttelte ungläubig den Kopf, denn ich hatte keine Ahnung, was ich zu diesem Thema beitragen könnte, aber ich nahm den Stein und dankte ihm dafür. Gleich darauf ging eine Tür auf und Wunderlich, mein kleiner Führer, kam in den Raum.
"Komm", piepste er, "ich zeige dir den Weg hinaus."
Als ich ihm wieder folgte, winkten die vier anderen mir nach und wünschten mir Glück. Es dauerte diesmal gar nicht lange, bevor wir im Freien waren.
"Geh fünfzig Meter geradeaus weiter", instruierte mich mein Begleiter. "Dort findest du deinen Rucksack wieder, und auch den Weg nach Hause. Aber sieh dich nicht um, sonst kommst du niemals heim. Alles Gute!"
* * * * *
Ich ging, ohne mich umzusehen. Wieder im hellen Tageslicht erschien mir mein Erlebnis verrückt, unmöglich. Doch in der Hosentasche lag der Stein, der mich wissen ließ, daß ich nicht geträumt hatte.
Ich fand den Rucksack und daneben die beiden Kübel, voll mit Heidelbeeren. Als ich zu unserer Hütte kam, sah ich meine Frau im Sonnenschein sitzen, die Beerenernte von gestern reinigend. Ihr Fuß sei merkbar besser geworden, sagte sie.
Aber sie lachte mich aus, als ich meine Geschichte erzählte. Den Stein hätte ich irgendwo gefunden und den Rest dazugeträumt, lachte sie. Und ich bin fast überzeugt davon, daß sie mir heute noch immer nicht glaubt....
Es ist, wie gesagt, schon lange her, seit der Heidelbeerenzeit. Ich habe viel an mein Erlebnis gedacht, und daran, was ich wohl tun könnte, um zu helfen. Aber ich bin zu keiner Lösung gekommen. Immer, wenn ich von meinem Erlebnis erzählte, hielten die Menschen mich entweder für einen Spaßmacher oder für nicht ganz normal, wenn ich in der Erzählung an den Punkt gekommen war, da ich Wunderlich getroffen hatte. Geglaubt hat mir bisher wohl noch keiner.
Der Stein liegt seit ein paar Monaten hier in meiner Schreibtischlade neben mir. Ich glaube, ich werde ihn wieder herausnehmen und bei mir tragen; vielleicht hilft er mir, zu helfen. DA - ER LEUCHTET!
Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, Schweden, 1979 & 1996
Zurück zu den 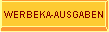 oder zur oder zur 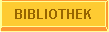
webmaster@werbeka.com
|